Geschichte des Blaudrucks
Blaudruck, es müsste richtiger „Blaufärben“ heißen,
da es sich um ein Reservedruckverfahren mit anschließender blauer
Färbung handelt. Den Ursprung findet man in Indien, einem Land mit Überfluss
an Baumwolle und Farben. Auch auf dem afrikanischen Kontinent ist der
Blaudruck zu Hause. Aus dem 4. Jahrhundert stammt der erste Fund einer
Wachsreserven- Blaufärbung, eine Kindertunika aus den Gräberfeldern
von Achnimpanopolis (Ägypten).
1550 brachte der holländische Maler Pieter Klock
van Aelst von einer Orientfahrt die Kenntnis vom Blaudruck mit nach
Hause. 1678 stellte eine Kattundruckerei in Amsterdam erste Blaudrucke
her. Dabei war eine Verbindung zu den Porzellanmustern zu erkennen.
Nach langer Zeit des Experimentierens und unter Einsatz
seines gesamten Vermögens gelang es Jeremias Neuhofer und dem Färber
Daniel Deschler 1689 (vor nun über 320 Jahren) die erste Manufaktur
in Augsburg zu eröffnen.
Aller guten Dinge sind drei: Farbe, Papp und Model.
Bis dahin war diese Technik in Deutschland nicht bekannt
und der Aufschwung, die steigende Nachfrage, ließen nicht lange
auf sich warten. Es entstanden innerhalb kurzer Zeit in Deutschland
zahlreiche Manufakturen. Anfang des 18.Jh. arbeiteten die Drucker einer
Werkstatt an bis zu 1000(!) Tischen und produzierten den beliebten
Stoff. Es entwickelte sich eine Sonderstellung für die Blaudrucker
in der Färberzunft
gegenüber den Schönfärbern (färbten Textilien bunt,
in rot, gelb, grün) sowie den Schwarzfärbern (Schlicht- oder
Schlechtfärber, färbten minderwertigen Stoff).
Das Blaudruck-Handwerk blühte und man konnte
recht gut davon leben. Ende des 18.Jh. wurden für den Druck Maschinen
eingesetzt, wie Perrotinen oder Walzendruckmaschinen. Leider hat
so eine Massenproduktion auch ihre Schattenseiten, da die individuell
entstandenen Muster immer schneller in den Hintergrund rückten.
Viele kleine Werkstätten konnten so auch der Konkurrenz bald nicht
mehr standhalten und mussten Anfang des 19.Jh. schließen. Einige
wenige Werkstätten
auf dem Land kämpften sich aber durch die Zeit. Die wunderschönen
Spitzenimitationen der Kantenmuster waren sehr begehrt, vor allem für
die Festtagstrachten. Echte Spitzen waren immer schon sehr teuer und
mit dem Blaudruck konnte man sich diese auch leisten, wenn man nicht
zu den Vermögenden zählte.
Es gibt auch heute noch viele Trachten, bei denen
Blaudruckstoffe verarbeitet werden (in nächster Nähe bei
den Sorben, aber auch bei den Bayern, Österreichern, Ungarn,
Tschechen, Slowaken und anderen). Gern werden Blaudrucke auch heute
noch in moderner Kleidung verarbeitet. Im 19. Jh. hatte der Blaudruck
nur noch für
die Landbevölkerung Bedeutung. Der Stoff war sehr haltbar, dauerhaft
und ließ sich gut als Alltagsbekleidung und auch als Arbeitsbekleidung
wie Schürzen (auch beidseitig bedruckt), Hemden, Tücher,
Bettwäsche
usw. verwenden. Das selbst gewebte Leinen wurde in die kleinen „Landblaudruckereien“ zum
Bedrucken und Färben gebracht. Sehr oft betrieb der Blaudruckmeister
noch eine Gastwirtschaft nebenbei, um die Zeiten der Arbeitsunterbrechung
abzusichern. Im Winter wird auch heute nur in Ausnahmefällen gefärbt.
Die Mütter ermahnten gern ihre Töchter:
„Wer im Winter nicht webt, kann sich im Sommer
den Hintern blau färben lassen."
Einen kleinen Aufschwung gab es für die Blaudrucker
vor und während des 2. Weltkrieges, was sich mit dem Mangel an
industriell hergestellten Textilien begründen lässt. Nach
dem Ende des Krieges folgte ein absoluter Niedergang der meisten Blaudruckbetriebe.
Erst in den fünfziger Jahren gründete ein Umsiedler aus
Schlesien in Pulsnitz (Sa) wieder eine Blaudruckerei. Die Blaudruckerei
Gerhart Stein, dessen Vorfahren stammten aus einer alten Blaudruckerfamilie,
die bereits 1633 als Schwarzfärber in Steinau a. d. Oder in Schlesien
erwähnt wurden. In Deutschland arbeiten heute etwa wieder ca.
25 kleine Werkstätten, meist Familienbetriebe, wie wir. In Sachsen
gibt es insgesamt nur 2 Werkstätten.
Reservedruckverfahren
Der Stoffdruck (Direktdruck, Zeugdruck) wurde im Mittelalter
hauptsächlich von den sehr begabten klösterlichen Damen ausgeführt.
Auch Künstler (Maler) haben Model-Muster entworfen. Dieses Verfahren
stellte später aber nur eine Nebenbeschäftigung der Tuchmacher,
Färber oder Formenschneider dar. Unsere Werkstatt druckt mit den
Modeln auch geeignete Farben direkt auf den Stoff, da sich damit auch
helle Stoffe mit blauen, roten, grünen oder auch braunen Mustern
verschönern lassen. Dabei bleibt der Stoff hell und wird nicht gefärbt.
Die Muster werden durch Hitze fixiert.
Lange Zeit wurden die Model von den Blaudruckern selbst
hergestellt. Aus dem 14. Jhd. stammen erste Belege für den eigenen
Berufsstand der Formenschneider. Die Herstellung dieser Druckstöcke
erfordert hohe Erfahrung und Geschick. Die ersten Muster waren Nachahmungen
der alten indischen Muster (Palmetten, Granatapfel).
Es gab weiterhin figürliche Darstellungen, wie
biblische Motive (Adam und Eva, Christi Geburt, Josua und Kaleb u.a.),
sowie vielseitige Darstellungen von Jagdszenen und Erntemotiven. Die
geometrischen Figuren stellten Imitationen von Webmustern dar. Blütenmotive,
Früchte, Sterne, Kanten und aufwendige Einzelmotive werden zur vielseitigen
Gestaltung von Stoffen und Tischwäsche verwendet.
Die Drucker haben auf der Wanderschaft die schönsten
Muster kopiert, also abgezeichnet und dadurch verbreiteten sich diese über
ganz Deutschland. Es sind bis heute sehr viele schöne Blaudruckmuster
in Museen, wie in Bautzen, Volkskunstmuseum Dresden , Münster, Jever
und in den noch produzierenden Betrieben, also auch bei uns, erhalten.
Nachempfindungen von typischen, auch bei uns zu findenden
Motiven sind Maiglöckchen, Kornblume, Nelkenmuster, Ährenmuster,
Karomuster, Biedermeierstreifen, Punkte, Traubendekor, Muschelmuster
und anderes. Jeder Druckstock erhielt eine Nummer, damit sich der Kunde
sein Muster selbst aussuchen konnte und diese auch schriftlich festgehalten
werden konnten. Es wurden sogar Spitznamen erfunden, wie: „Blitz
und Donner“, „Kleeblatt“, „Tannenzapfen“, „Waschbrettmuster“, “Spinnen“, „Katzenpfötchen“, „Stachelbeere“ und
anderes. Dann wusste der Meister auch ohne Nummer, welches Muster gemeint
ist!
Model
Unsere Druckstöcke (ca. 250 Stück) stammen
aus verschiedene,n nicht mehr bestehenden alten Werkstätten Sachsens
(Großenhain, Meißen, Freiberg), die wir käuflich erworben
haben, nachdem sie uns von Erben oder ehemaligen Mitarbeitern aus den
alten vergangenen Blaudruckbetrieben angeboten wurden. Damit können
wir nun mit den uralten historischen Modeln die gleichen schönen
Dinge, wie vor hunderten von Jahren im Original, auch heute wieder
entstehen lassen. Damit steht unsere Werkstatt in bester Tradition
bodenständiger,
alter deutscher Handwerkskunst.
Einen großen Teil der Druckstöcke fertigte
Formstecher Ewald Drescher aus Pulsnitz nach alten Vorlagen und auch
unseren Ideen an. Einige Model sind auch nach unseren eigenen Entwürfen
entstanden. (Weinmotive, Christi Geburt und Ostermotive)
In den Anfängen der Model waren diese reliefartig,
aus hartem Obstholz geschnitzt. Das Dekor dieser Model ist meist etwas
grob. Man ging dann dazu über, ein sich wiederholendes Muster zu
schnitzen (Rapport), damit es die Wirkung eines endlosen Gewebes erhielt.
Durch den Einsatz von Messingstiften und Messingblechstreifen konnten
die Muster immer feiner und filigraner werden. Die Inder verwenden Teakholz
und können damit auch sehr feine Konturen erreichen. Diese Model
sind aber für den Blaudruck mit dem recht dickflüssigen Papp
nicht gut geeignet. Feine Muster können im Holz nicht tief genug
gestochen werden.
„Gestochen scharf - bestechend schön“
Bei der Herstellung werden verschiedene Holzarten
miteinander verleimt, um das Reißen des Holzes zu verhindern.
Die oberste Schicht, in die das Muster geschnitzt und die Messingstifte
geschlagen werden, besteht aus hartem Obstbaumholz (Birnbaum). Die
Model sind der wertvollste Schatz einer Blaudruckerei. Bei guter Pflege
kann man sie über
Jahrhunderte verwenden.
Auf unserer Internetseite wollen wir Ihnen auch einige
unserer wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die Model, auch Druckstöcke
genannt. Sie werden vom Modelstecher, der auch als Formenstecher bezeichnet
wird, hergestellt. Sie bestehen aus mehreren Schichten, die kreuzweise
verleimt sind.
Die Griffseite besteht dabei aus leichterem weichen
Holz und für die Seite mit den kunstvollen Mustern wird gutes Obstholz,
z.B. gut getrocknetes und gelagertes Birnbaumholz verwendet. Die Muster
werden in das Holz geschnitzt. Filigrane Details des Musters werden durch
ins Holz eingeschlagene Messingstifte und Streifen hergestellt.
Ein großer Teil der bei uns verwendeten Model
stammen aus der Zeit, als das Blaudruckhandwerk noch weit verbreitet
war und in voller Blüte stand. Diese kunstvollen Model sind also
bereits 100 bis 200 Jahre alt. Vielen dieser Model sieht man das auch
an. Hier und da entstehen durch die kleinen Beschädigungen deshalb
auch kleine Unregelmäßigkeiten im Druck. Das unterstreicht
jedoch die Einzigartigkeit und macht den besonderen Reiz der damit bedruckten
Stoffe aus.
Einige schöne Model, die sich im Laufe der vielen
Jahre im Holz verzogen haben oder tiefe Risse bekommen haben, ließen
wir in der Werkstatt vom Formenstecher Ewald Drescher in Pulsnitz, entsprechend
den ausgedienten Vorlagen, neu herstellen.

|
Kante Nr. 15
Hersteller Ewald Drescher,
nach alter Vorlage |
 |
Kante Nr. 96
alter Druckstock, sehr gut
erhalten, zum Drucken häufig
eingesetzt |
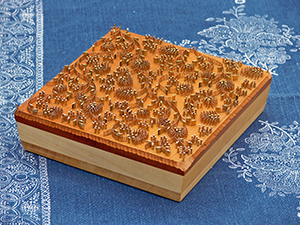
|
Füllmuster
Nr. 110
Hersteller Ewald Drescher,
nach alter Vorlage |
 |
Motiv Nr. 122
altes Model, vollständig aus Holz
in filigraner Schnitzarbeit
hergestellt |

|
Kante Nr. 211 |
 |
Kante Nr.220
altes beschädigtes Model und
nach dieser Vorlage neu geschaffenes
Model von Ewald Drescher |
|
|
|